Vom Körper aus denken: Körperlesekunde als neue Vermittlungspraxis?
04.08.2020

Kritisch, progressiv und zukunftsgewandt soll die Kunst- und Kulturvermittlung sein. Doch wie lässt sich dieser Anspruch einlösen? Ein Ansatz ist die sogenannte Körperlesekunde oder Corpoliteracy, die die Anerkennung körperlicher Unterschiede in den Mittelpunkt rückt. Sie kann den theoretischen Rahmen dafür liefern, kreativ-kritische und sinnstiftende Vermittlungsangebote zu entwickeln, die sowohl analoge als auch digitale Praktiken berücksichtigen.
Von: Daniel Neugebauer
Einleitung und Vision
Ungezwungen mit hochdiversen Gruppen im Museum umgehen können, ohne Angst, das Falsche zu sagen, unbewusst auszuschließen oder mit Worten zu verletzen. Nicht nur viele Worte machen, sondern kreativen Körpereinsatz in der Vermittlung einsetzen und damit Menschen mit verschiedenen Lerngeschwindigkeit und -fähigkeiten erreichen. Die Erfahrungen, die sich im Körper, in den Muskeln, Sehnen, Knochen, Verspannungen, Nerven der Besuchenden angestaut haben, für konstruktive Begegnungen zu nutzen wissen. Keine Vorurteile über Institutionen oder Menschen verstärken, sondern überraschen können. Sich frei zwischen digitalem und analogen Raum bewegen können. Die Gewissheit haben, dass man den kulturellen Schatz und das Wissen, mit dem man arbeitet, nicht nur mit den immer gleichen Privilegierten teilt, sondern mit Menschen, die mit diesem Schatz unsere Welt verändern können, gerechter machen können - so ungefähr stelle ich mir das Mindset zukünftiger Vermittler*innen in Museen vor. So oder so ähnlich könnte die Haltung von körperleskundigen Vermittler*innen aussehen.
Die zunehmende gesellschaftspolitische Anerkennung von kultureller Bildung und Vermittlungsarbeit in Kulturinstitutionen sorgte dafür, dass in den letzten Jahren auch von Publikum, Gesetzgebern und Peers zunehmend neue Ansprüche formuliert wurden. Im Fokus progressiver Vermittlungsarbeit steht folglich nicht mehr nur Was - also welche Inhalte - vermittelt werden, sondern das Wie. Vermittler*innen sehen sich somit einem komplexen Arbeitsfeld gegenüber, auf das die klassischen Ausbildungswege nur bedingt vorbereitet haben. Dies gilt besonders für Vermittler*innen, die schon lange aktiv sind. Hieraus ergibt sich also ein Spannungsfeld bzw. inhaltliche Herausforderungen. Mein Beitrag ist der Vorschlag, anhand eines neuen Wortes, die gegenwärtigen Herausforderungen als kreative Chance zur inhaltlichen Weiterentwicklung und nicht als Bedrohung des Status Quo zu sehen. Körperlesekunde oder Corpoliteracy ist eine Idee, eine Denkrichtung, eine Haltung, die ich im Folgenden, unterlegt von einigen Praxisbeispielen, vorstellen möchte.

Barrierefreiheit ist vielleicht das klassischste Wie der Vermittlungsarbeit. Das Nachdenken über Barrieren wurde ab ca. 2005 zunehmend abgelöst durch die Idee der Inklusion, die neben praktisch-technischen Aspekten von Vermittlung vermehrt soziopolitische Visionen einforderte. Die Fragen danach, wer durch wen inkludiert werden sollte, sorgte für die Erkenntnis, dass Ausgrenzungen und Ausschlüsse nie isoliert, sondern als Bündel von Faktoren und damit intersektionell gelesen werden müssen. Der freie Markt, also vor allem große multinationale Konzerne, Banken, Pharmaunternehmen und dergleichen, hatte Diversität als Unternehmensziel schon länger im Visier und konnte belegen, dass Diversität in Teams für mehr Produktivität und Kreativität sorgt und damit für einen höheren wirtschaftlichen Erfolg. Die Kultur musste ihre Position dazu finden: Entweder das marktorientierte Denken kopieren oder aus einer kreativ verstandenen sozialen Verantwortung heraus einen alternativen Weg beschreiten. Körperleskundige Kultur könnte diesen alternativen Weg säumen. Angesichts der zum Teil veralteten Personalstrukturen wurde eine Sensibilisierung für Antidiskriminierungsarbeit und kritisches Weißsein in der eigenen Institution unerlässlich – als Reaktion auf postkoloniale und postmigrantische Fragen, die selbstverständlich auch in der Kulturarbeit eine große Rolle spielten und spielen.
Zentral muss aber nicht der Blick nach innen, sondern nach außen sein. Publika, die direkten Gesprächspartner*innen von Vermittler*innen, können kaum mehr klassisch demografisch wie Konsument*innen angesprochen werden. Es gilt, ein Auge für Selbstdefinitionen zu bekommen, und Begriffe wie PoC und BPoC nicht als Bedrohung wahrzunehmen, sondern als Chance. Ich bin überzeugt, dass solche Wortschöpfungen keine ‚bürgerliche Mitte‘ zum Schweigen bringen, sondern vielmehr einer neueren Mitte eine Stimme verleiht. Ähnlich sehe ich den Vorschlag von Körperlesekunde oder Corpoliteracy als Denkrichtung einer Vermittlungspraxis, die sich aus dem Anerkennen von körperlichen Unterschieden speist und diese produktiv machen möchte. Das gilt sowohl für den analogen Museumsraum als auch die digitalen Zugänge zu Wissen, Austausch und Kultur.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass zeitgemäße Vermittler*innen selbst Expert*innen sein sollten, was Diskriminierungsformen (Ableismus, Sexismus/ Homo- und Transmiseoismus, Klassismus, Rassismus, u. a.) und ihre strukturelle und institutionelle Verankerung betrifft. Und das ist auch gut so, geradezu unverzichtbar, wenn man den Glauben an die Relevanz von Kulturinstitutionen nicht aufgeben möchte. Ich habe diese Aspekte derart verdichtet, um die Überforderung, die für einige Vermittler*innen hier entsteht, begreiflich zu machen. Die Überforderung von Institutionen allgemein oder Vermittlungsabteilungen im Besonderen kann im Verständnis einiger der angerissenen Konzepte liegen oder in der Übersetzung in eine institutionelle Praxis, die zum jeweiligen Haus passt. Folglich fehlt es oft an Lust, sich mit diesen Aspekten einer kritischen, zukunftsgewandten Museumsarbeit auseinanderzusetzen. Die wichtigen neuen Vokabeln, die nötig sind, um soziale und ästhetische Realitäten in Deutschland und darüber hinaus zu beschreiben, werden zu Reizworten. Und das ist wahnsinnig schade.
Mein Vorschlag zur Lösung des Knotens ist, ihn noch fester zu zurren. Bündelt man die beschriebenen Problematiken, bleibt ein Kondensat übrig, aus dem sich Lösungen ableiten ließen: Körperlesekunde/Corpoliteracy als möglichen Sammelbegriff oder Behälter zu lesen, aus dem Vermittelnde leichter Zugriff zu unterschiedlichen Wissensformen bekommen können. Wenn sich eine Institution körperleskundig entwickelt, Corpoliteracy einfordert, aufbaut und weitergibt, dann wäre das ein Bekenntnis zu all den oben genannten Theorien und Praktiken. Aber eben auch ein work in progress, ein Weg, der individuell ausgestaltet werden kann. Der Neologismus Körperlesekunde/Corpoliteracy beschreibt in meinem Verständnis eine Haltung, eine Fertigkeit, eine Fähigkeit zur Analyse, zur Reaktion und zum Widerstand und könnte passgenau für verschiedene Institutionen auf- und ausgebaut werden.
Soweit meine Utopie einer vermittelnden Praxis, zu der ich eine schlüssige Theorie noch schuldig bin. Mein Impuls hier ist einfach: Ich möchte Lust an kritisch-kreativer Vermittlungsarbeit wecken. Im Folgenden erkläre ich kurz, aus welchen Ideen, Theorien und Praktiken sich der Begriff Corpoliteracy speist und wie diese Ideen mit der Vorstellung eines Museums als sozialer Kraftzentrale einhergeht. Ich beginne mit einem kurzen theoretischen Überblick zur Thematik, um die Begrifflichkeiten und Referenzrahmen vorzustellen, um anschließend zwei Praxisbeispiele vorzustellen: Zunächst die inklusive Praxis am Van Abbemuseum in Eindhoven und danach das forschende Programm “Körper lesen!” am Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Anhand dieser Beispiele soll die Theorie in die Vermittlungspraxis übersetzt, damit verständlicher und letztlich adaptierbarer gemacht werden.
Theoretische Überlegungen
Meiner Meinung nach können Institutionen ihre Rolle in der Gesellschaft stärken, wenn sie sich a) als soziale Kraftwerke verstehen und b) analoge und digitale Prozesse und Körper nicht mehr voneinander trennen. Der Begriff des Museums als Kraftwerk geht auf den Kunsthistoriker Alexander Dorner zurück, der in seinem Standardwerk „The Way beyond Art“ seine Überlegungen zum sozial engagierten Kunstmuseum festhielt (DORNER 1947). Das Van Abbemuseum im niederländischen Eindhoven, in dem ich 2012–2018 tätig war und dessen Praxis ich später vorstellen werde, hat diesen Begriff zu seinem Leitsatz gemacht und bezeichnet sich als social powerplant. Körperlesekunde ist also ein erster Vorschlag, um innerhalb einer sozialen Agenda analoge und digitale Prozesse zusammen zu denken. Corpoliteracy referiert hierbei auf die Notwendigkeit, Körperzeichen wie Hautfarbe, Behinderung, religiöse Symbole kritisch und nicht-diskriminierend lesen zu können. Gerade die Intersektionen von digitaler und analoger Realitäten zu fassen, ist eines der wichtigsten Anliegen, wenn man theoretische Ideen auch in die Praxis umsetzen will.
Hier ein kleines Gedankenexperiment: Stellt man sich Kulturinstitutionen als Behälter für Körper vor – physisch wie digital - wird das deutlicher. Ich benutze den Begriff Körper hier vereinfacht als System von Zeichen – das können im analogen Raum kontrollierte Zeichen sein, wie beispielsweise modische Elemente oder religiöse Symbole oder eben Zeichen, die nicht oder kaum zu kontrollieren sind, wie Hautfarbe, Behinderungen, Falten Narben etc. Es scheint offensichtlich, dass in unseren Schulen und Kulturinstitutionen kein adäquates Werkzeug bereit steht, um das Lesen von Körpern, sowie das Lesen und Erfassen mit dem Körper strategisch zu begreifen.
Dies gilt in gleichem, wenn nicht höherem Maße, für die digitalen Körper, die den institutionellen Kulturraum einnehmen, in Kunstwerken, durch Vermittlungstechniken, Social Media und KI sowie virtuelle Sammlungen. Auch im digitalen Raum präsentieren sich Menschen, oft sogar stärker als im analogen, und hinterlassen Zeichen. Zeichen als Daten: Durch soziale Medien bewusst und mehr oder weniger kontrolliert, durch ungefragtes Datensammeln von großen Unternehmen und anderen Big Data-Kraken - unbewusst und kaum noch kontrollierbar - also genau wie bei den oben beschrieben Markern der physischen Erscheinung. Der Aufbau einer Körperlesekunde, oder Corpoliteracy, wäre also eine Kernaufgabe für das Museum der Zukunft, und zwar als physische und digitale Variante. Das bedeutet im Klartext: Es fehlt eine intersektionelle Pädagogik, oder eben eine Schule des zeitgemäßen Sehens, eine Schule des Körperlesens. Neben Schulen können und müssen Kulturinstitutionen und Museen diese Orte sein.
Die Kulturanthropologin Gloria Wekker erklärt Intersektionalität als eine Theorie und Methodik, die auf dem Denken Schwarzer Feminist*innen basiert und die Komplexität identitätsbezogener Themen analysiert und problematisiert. Das Buch „White Innocence: Paradoxes of Colonialism and Race“, das sie 2016 veröffentlichte, gilt als bedeutendes dekoloniales Werk (WEKKER 2016). Anhand von medialer Dokumentation, historischen Quellen, quantitativer Daten und persönlichen Erlebnissen arbeitet Wekker heraus, wie in den Niederlanden die kolonialen Verstrickungen der eigenen Geschichte und Gegenwart zugunsten einer liberalen, weißen Unschuld geleugnet werden. Identitätskonstruierende Marker wie Geschlecht, Herkunft, Klasse, Sexualität und Religion sind immer auch Elemente, die diskriminierend gelesen werden können und stehen grundsätzlich in Wechselwirkung zueinander und sind somit nie isoliert analysierbar. Erweitert in den digitalen Raum durch Avatare, digitale Identitäten bis hin zu Deep Fakes, also extrem glaubwürdigen Bewegtbildmanipulationen, potenziert sich diese Komplexität noch einmal. Digitalität ist eine nützliche Erweiterung der aufgezählten Aspekte von Intersektionalität.

Ganz konkret: Kulturinstitutionen sollten verstehen, dass kulturelle Prozesse (verstanden als Interaktionen in analogen oder digitalen Kulturzonen) immer auch damit verbunden sind, dass Körper, Avatare, Identitäten auf Anzeichen von Geschlecht, Klasse, digitale Filter, Fakes, sexuelle Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, Alter usw. gescannt werden, um sie dann zu bewerten und zu kategorisieren. Das bedeutet in der Konsequenz, dass diese Prozesse strategisch gesteuert werden können und m. E. auch müssen. Analoge und digitale Körperleskundigkeit könnte kulturelle Prozesse profund verändern. Corpoliterate zu sein bedeutet dann, in der Lage zu sein, eine komplexe, intersektionale Lesung von Körpern und deren Korrelationen durchzuführen und Corpoliteracy als kollektiven Akt mit diversen Akteur*innen wahrzunehmen.
Praxisbeispiel 1: Van Abbemuseum, Eindhoven
Museen sind ideale Orte, um darüber nachzudenken, wie Körper kategorisiert sind, denn sie sind mit Körpern und Objekten gefüllt. Besuchende (on- und offline), Mitarbeitende, Kunstwerke stehen in einer solchen Nähe zueinander, dass es oft unmöglich ist, Interaktionen zu vermeiden. Von queer und crip-Aktivismus inspiriert, leitete das Van Abbemuseumaus diesen Interaktionen verschiedene Vermittlungsprogramme ab. Das Wichtigsten war das Special Guests Programm, das viele zielgruppenspezifische Projekte für Menschen mit verschiedenen Behinderungen bündelte und damit den Weg dafür ebnete, Inklusion zum institutionellen Ziel werden zu lassen sowie Queering the Collection, das sich mit Theorie und Praxis von Vermittlung aus der Perspektive nicht-normativer Sexualitäten und Gender-Identitäten beschäftigt.
Diese Programme bilden zusammen mit dem Konzept des Museums als soziales Kraftwerk den Kern eines neuen Archivs körperlicher Aspekte des Museumsbesuchs.
Der vom Van Abbemuseum entwickelte multisinnliche Ansatz in der Vermittlung ist ein Beispiel für die intersektionale Museumspraxis, deren Schwerpunkt auf der Analyse und dem Gebrauch aller Sinne liegt. Das Primat des Sehens wird unterlaufen, sodass sich verschiedene Sinneserlebnisse ergänzen und bereichern können. Hierdurch entsteht ein Mehrwert für Besuchende mit und ohne Behinderungen.

Um offener über queere Themen informieren und sprechen zu können, wurde unter anderem ein Queer-Glossary erstellt, um Diskussionen über die politischen Dimensionen von Gender und darüber hinaus zu ermöglichen. Diese (Online-)Broschüre wurde später in einen Schal verwandelt, der zusammen mit Umhängen und Jacken als Vermittlungswerkzeug diente. Besuchende wurden ermutigt, in und mit dieser ‚Verkleidung‘ den eigenen Körper beim Entdecken queerer Aspekte von Sammlungsobjekten anders wahrzunehmen oder mit dem Körper wahrzunehmen und zu lernen. Das heißt konkret: Beim Betreten des Sammlungsbereichs des Museums hat man die Möglichkeit, Kleidungsstücke und Schals auszusuchen und anzuziehen. Auf diese Kleidungsstücke sind Abbildungen von Werken gedruckt, die man beim Rundgang wiederfindet. Findet man etwas wieder, kann man Knöpfe öffnen und in Taschen Informationen zum Kunstwerk lesen, mit queerem Fokus. Taucht in diesen Beschreibungen Fachvokabular auf, kann man den Schal mit dem Glossar benutzen, um das Wort zu erklären. Manchmal sind die Infos an merkwürdigen Stellen der Kleidung versteckt. Man verrenkt sich und wird quasi zur Performance, zur Attraktion im Museum. Manchmal benötigt man Hilfe und muss andere Menschen Dinge vom eigenen Rücken ablesen lassen, man gerät in eine körperliche Interaktion.
Gleichzeitig fühlte sich der seidige Stoff sinnlich an und schön, gleichzeitig entstanden komische und zärtliche Momente bei der Kunstentdeckungstour. Diese ‚Drag-Tour‘ funktionierte ausgezeichnet, überraschenderweise besonders bei Teenagern. Neben der veränderten eigenen Wahrnehmung wurden die Nutzer*innen ebenfalls dafür sensibilisiert, wie anders sie selbst durch die restlichen Besucher*innen wahrgenommen wurden. Das Glossar wurde kürzlich ebenfalls in die niederländische Gebärdensprache übersetzt. Begriffe wie Drag Queen, Intersektionalität, Male Gaze oder Homonationalismus gibt es dadurch nun im offiziellen niederländischen Gebärdenvokabular. So können über die Grenzen von Fähigkeiten und Einschränkungen hinweg, relevante und inklusive neue Diskurse angeschoben und so ein weiterer Schritt in Richtung einer kreativen intersektionellen Praxis des Museums gegangen werden. Wenn Institutionen wie Museen die unbewussten Prozesse der Wahrnehmung des eigenen und anderer Körper aus dem unbewussten in den bewussten Bereich bringen, entsteht zunächst Neugier und dann neues Wissen. Körperlesekundig zu sein bedeutet hier, in der Lage zu sein, eine komplexe, intersektionale Lesung von Körpern und deren Korrelationen kreativ zu steuern.
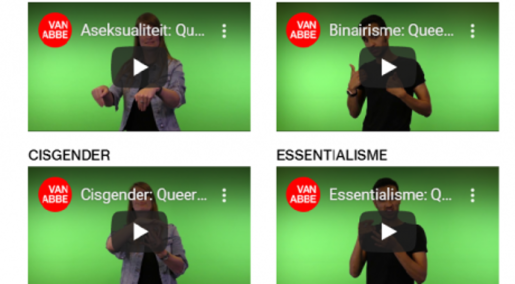
Praxisbeispiel 2: Haus der Kulturen der Welt (HKW), Berlin
Im Rahmen des HKW-Langzeitprojekts Das Neue Alphabet untersucht das HKW bis 2021, welche Wissenssysteme wichtig sind, um sich in der heutigen Welt orientieren zu können. Das Team der Kulturellen Bildung setzt innerhalb dieses Bezugssystems einen Fokus auf ‚Körperalphabete‘, beziehungsweise versucht, durch Corpoliteracy zunächst einen Einstieg in das weite Feld körperlicher Vermittlungsformen zu ermöglichen. Wichtige bildungspolitische Aspekte wie intersektionelle Pädagogik oder schulische Antirassismusarbeit lassen sich in diesem Kontext gut diskutieren. Welche Haltung wollen wir in der Bildungsarbeit einnehmen? Diese Grundfrage entstand bei der Konzeption des spekulativen Corpoliteracy-Programms Körper lesen! (September 2019) in Konversationen mit dem Bildungsteam der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Zum einen bezeichnet Haltung eine bewusste inhaltliche oder politische Verortung, zum anderen einen körperlichen Zustand.
So wuchs das Interesse an Körpersemiotik und Körperepistemologie, mit denen zuvor schon andere Institutionen gearbeitet hatten: Die Wortschöpfung „Körperlesekunde“ oder „Corpoliteracy“ stammt aus dem Berliner Kunstraum SAVVY Contemporary. Im zur documenta 14 erschienenen Band eine Erfahrung beschreibt Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Gründer und Künstlerischer Leiter des SAVVY, sein Interesse an der „Möglichkeit einer Körperlesekunde (corpoliteracy), die den Körper als Forum, Bühne, Schauplatz und Medium des Lernens, als Wissen ansammelndes, speicherndes und weitergebendes Gefüge oder Organ kontextualisiert. Daraus ergibt sich, dass der Körper nicht ausschließlich mit dem Gehirn gleichgeschaltet, sondern auch unabhängig von ihm erinnerungsfähig ist, dass er erworbenes Wissen performativ, also durch das Prisma von Bewegung, Tanz und Rhythmus behalten und weitergeben kann“ (NDIKUNG 2018). Für diesen inhaltlichen Impuls, mit dem wir in diesem Programm weiterarbeiten, bin ich den Kolleg*innen im SAVVY extrem dankbar.

Das dem Körper innewohnende Wissen ist kulturell geprägt, Körper sind kulturell codiert; in ihnen manifestieren sich Macht- und Dominanzverhältnisse. Auch die Grenzlinie zwischen ‚normalem‘ und ‚nicht normalem‘ Körper, zwischen alt und jung, be_hindert und nicht be_hindert, gesund und krank ist Ergebnis ständiger Aushandlungen durch gesellschaftliche Kollektive und politische Rahmenbedingungen. Wie kann die Kulturelle Bildung dazu ermächtigen, die hier beschriebenen Mechanismen zu erkennen oder gar zu durchbrechen? Kann Körperlesekunde helfen, neue Formen von Bildung in Kitas, Schulen, Universitäten und Kulturinstitutionen zu entwickeln, die den Lebensrealitäten vieler Menschen Rechnung tragen? Kann eine geschulte Kundigkeit beim Lesen von Körpern dabei helfen, Vorurteile und Ressentiments abzubauen? Diesen und weiteren Fragen ging das Programm durch Beiträge künstlerischer, akademischer und pädagogischer Auseinandersetzung nach.
Olave Nduwanje beschrieb in einer Spoken Word-Performance ihre Strategien, sich Blicken zu widersetzen (NDUWANJE 2019). Ihr Schwarzer, migrantischer Trans*-Körper ist permanent wertenden, urteilenden und sexualisierenden Blicken ausgesetzt. Ihre Erfahrungen, künstlerisch transformiert, können Vermittler*innen sensibilisieren, die Augen öffnen – auf eine kritische Art und Weise. Das Bildungsteam von iPäd in Berlin setzt Konzepte zu intersektioneller Pädagogik um. Von ihren Strategien der Sensibilisierung von Jugendlichen können sich Vermittler*innen im Kulturbereich viel abschauen: In praktischen Übungen wird anschaulich gemacht, wie vielfältig Begriffe wie ‚normal‘ verstanden werden können, wenn man sie aus verschiedenen Perspektiven betrachtet, dass eine Kategorisierung in normal/nicht-normal letztlich niemandem hilft und zerstörerisch wirkt. Jules Sturm und Angelo Custódio machten vor, was passiert, wenn Gedanken und Gefühl, Körper und Geist miteinander ringen. Nadja Buttendorf machte das Gegenteil zu den unzähligen Schmink-Tutorials auf Youtube: Sie lehrte den Besuchenden des Programms, wie man sich möglichst hässlich schminkt. Auch solche kleinen Gesten des Widerstands, mit Witz und Kreativität umgesetzt, könnten Eingang in das Vermittlungsportfolio von Institutionen finden.
Der Fachbereich Mode der Universität der Künste Berlin exerzierte dies für Mode für nicht-normative Körper durch. Gleichzeitig erinnerten forschende Aktivist*innen wie Ayse Gülec daran, dass Körperpolitiken nicht nur spaßig sind, sondern dass ein Wissen um strukturellen Rassismus (z. B. im Fall der Morde des NSU) notwendig sind, um als Institution relevante Antworten auf die Fragen der Gegenwart finden zu können. Neben Body-, Fat- und Slut-Shaming wurde das Thema Altersdiskriminierung angesprochen. Auch hieraus lassen sich interessante neue Impulse für neuere pädagogische Arbeitsgebiete wie der Kulturgeragogik ableiten. Eurythmie und Feldenkrais könnten als Ergänzung zu Yoga im Klassenraum und in Museen Einsatz finden, um rationale Inhalte in Körperwissen zu überführen, ein großer kreativer Entdeckungsbereich eröffnet sich. In der Mediathek auf der Website des HKW sind als Anregung hierzu verschiedene Video- und Audioaufzeichnungen zu finden.
Fazit
Museen sind immer auch politische Akteure und das erfordert ein Verständnis der politischen Dimensionen von Körperlichkeit sowie deren strategische und praktische Implementierung in Vermittlungskonzepte von Institutionen. Wenn ein Museum erkennt, dass es ein politischer Akteur in der Gesellschaft ist, muss es auch die Körper, die mit ihm in Verbindung stehen, als solche erkennen: als fließende Strukturen sozialer Konstellationen. Diese Vermittlungsstrategien können die Mission von sozial engagierten Museen (nach Vorbild der beschriebenen Social Power Plants) beeinflussen, dabei also auch den Underdog-Status von Vermittlungsarbeit verbessern und dabei Kreativität im Team freisetzen.
Ergänzt durch digitale Praktiken können körperleskundige Institutionen Besuchenden digitale Handlungsmacht vermitteln, um zwischen Online-Shaming, Mobbing, Porno und Deep Fakes mit der eigenen Körperlichkeit selbstbewusst umzugehen. Die Herausforderung besteht darin, Intersektionalität nicht nur auf analog-körperliche oder soziale Weise zu denken, sondern diese um den Faktor der (digitalen) Körperlichkeit zu erweitern. Museen besitzen das Potenzial zu dieser Erweiterung: Durch das Erlernen von physischer und digitaler Corpoliteracy können das Museum und seine Besucher*innen sowie User*innen festgelegte Vorstellungen über Körper und deren Wahrnehmung überdenken und neu lernen.
Ohne der Komplexität und den Schwierigkeiten, die bei der zukünftigen Vermittlungsarbeit noch anstehen, aus dem Weg gehen zu wollen, darf man sich getrost auch über dieses Potenzial freuen. So entsteht Motivation für sinnstiftende Museumspraktiken der Zukunft. Meiner Meinung nach eine durchaus realistische und vor allem dringend notwendige Utopie.
Dieser Text basiert auf dem Vortrag „Körperleskunde als Vermittlungsmethodik?“ von Daniel Neugebauer im Rahmen der Tagung „Diversität in der Archäologie: erforschen, ausstellen, vermitteln“ des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz (smac) vom 15.05.- 17.05.2019.
Er entstand unter Berücksichtigung vieler Ideen von Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Elena Agudio, Antonia Alampi (SAVVY Contemporary, Berlin); Sepake Angiama, Clare Butcher (documenta 14, Athen/Kassel); Marleen Hartjes, Loes Janssen, Olle Lundin (Van Abbemuseum, Eindhoven); Eva Stein (Haus der Kulturen der Welt, Berlin) und Jasmin Vogel (Kulturforum Witten, zuvor Dortmunder U).
Literatur:
DORNER, Alexander: The Way Beyond Art (New York 1947).
NDIKUNG, Bonaventure Soh Bejeng: „Corpoliteracy“. In: Sepake Angiama/Clare Butcher (Hrsg.). eine Erfahrung. documenta 14 (Berlin 2018) S. 89-96.
NDUWANJE, Olave: Do Not Read This Body (Berlin 2019).
RENSMA, Anne; LUNDIN, Olle; NEUGEBAUER, Daniel: “A Museum Can Never Be Queer Enough”: The Van Abbemuseum as a Testing Ground for Institutional Queering, Routledge, January 2020, In book: Museums, Sexuality, and Gender Activism, pp.278-287.
WEKKER, Gloria: White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race (Durham 2016).




